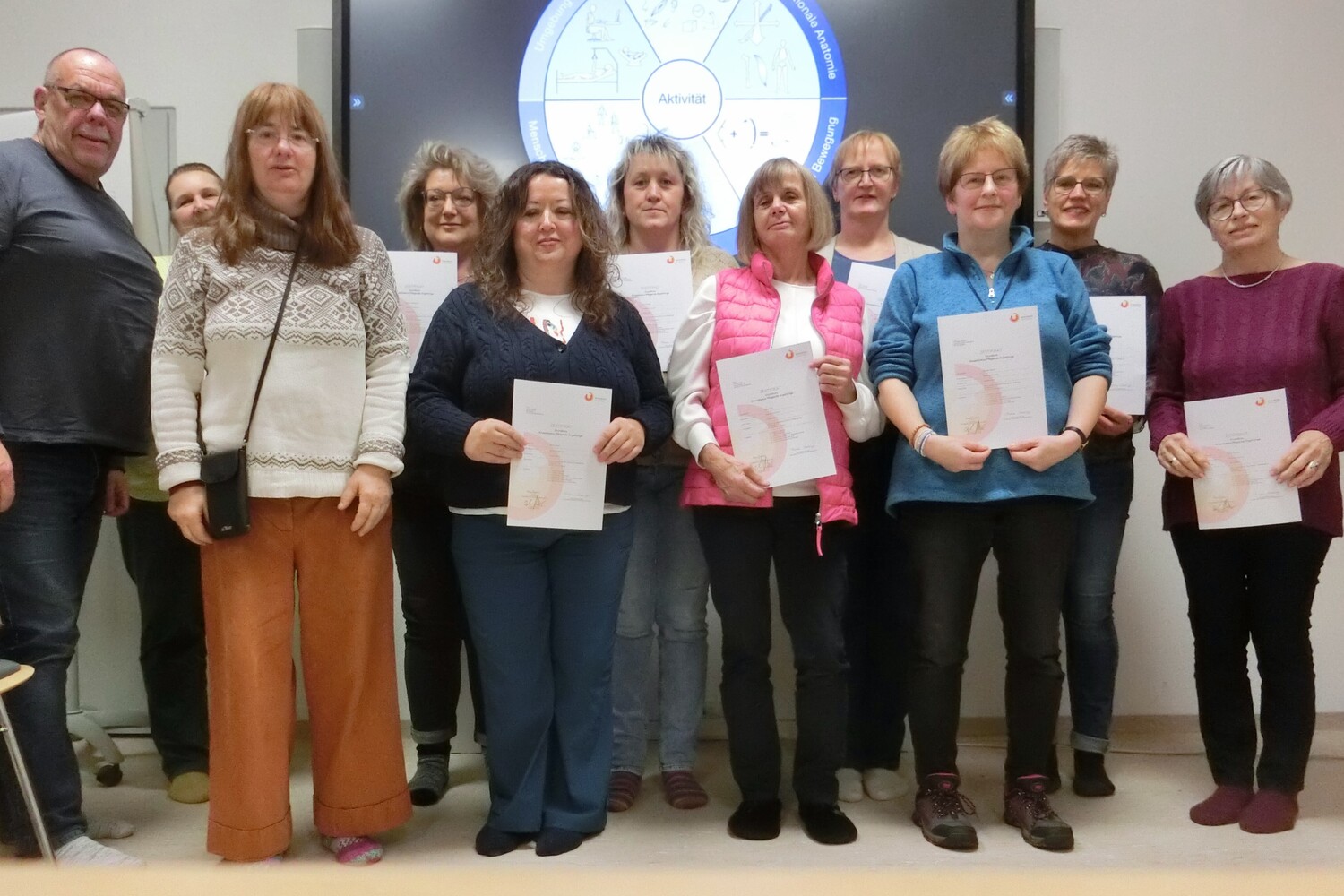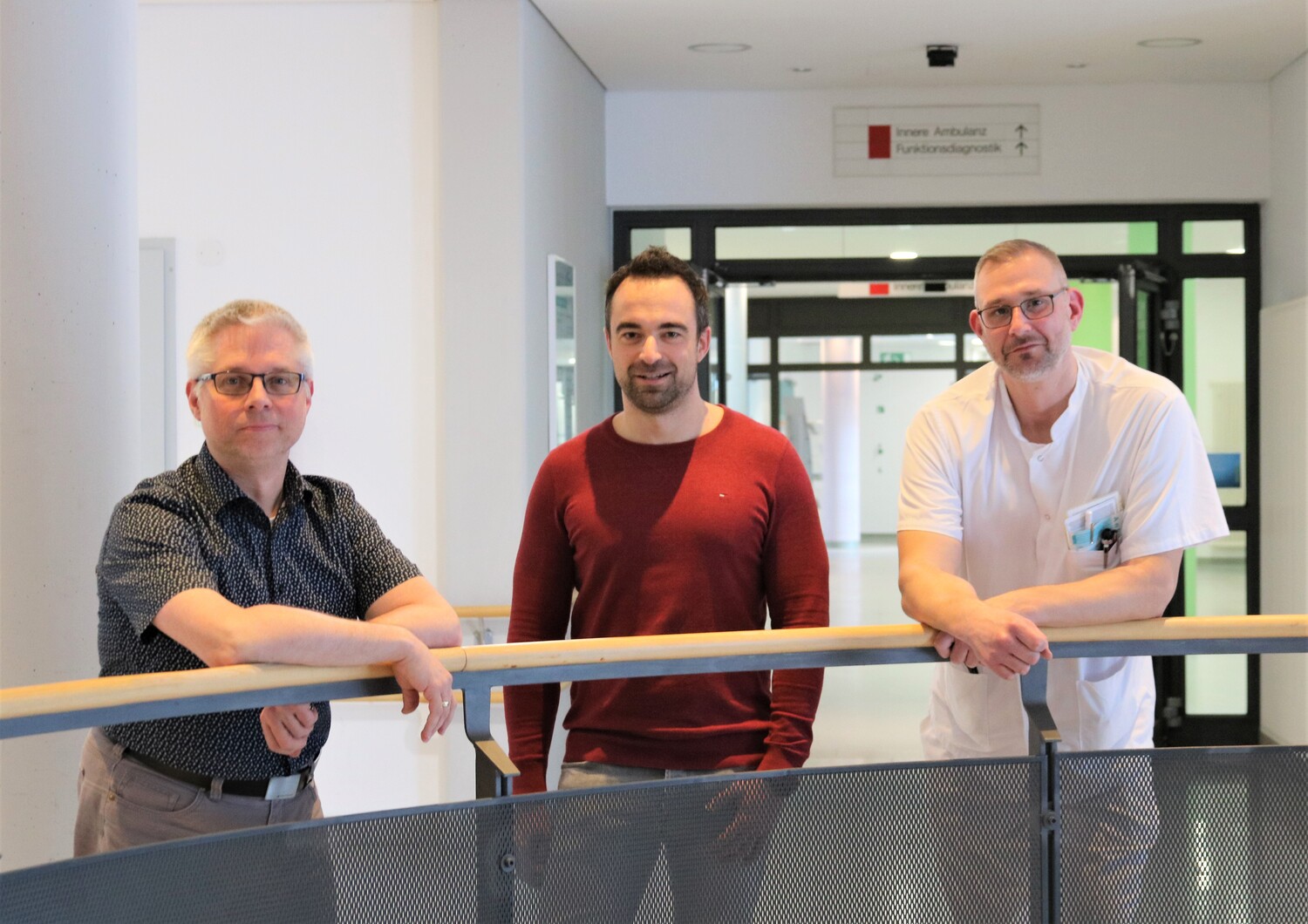- Kliniken & Zentren
- Klinikum Marktredwitz
- Allgemein- und Viszeralchirurgie
- Ambulantes Onkologisches Zentrum
- Anästhesie- und Intensivmedizin
- Brustzentrum
- Diagnostische und Interventionelle Radiologie
- Diabetologie
- Frauenklinik
- Geburtshilfe
- Gefäßchirurgie
- Innere Medizin
- Kardiologie
- Notfallmedizin
- Nuklearmedizinische Abteilung
- Orthopädie und Unfallchirurgie
- Physikalische Therapie
- Pneumologie
- Prostatazentrum
- Sportklinik
- Lokales Traumazentrum
- Urologie und Kinderurologie
- MVZ Fichtelgebirge - Marktredwitz
- Klinikum & Medizincampus Selb
- MVZ Campus Selb
- MVZ Fichtelgebirge - Selb
- Klinikum Marktredwitz
- Patienten & Besucher
- Ärzte & Einweiser
- Klinikum
- Beruf & Karriere
- Kontakt
- Babygalerie
Notfall
In lebensbedrohlichen Notfällen
Rettungsleitstelle von Feuerwehr, Rettungsdienst und Notarzt.
Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Außerhalb der Sprechzeiten vermittelt man Sie an den nächstgelegenen notdiensthabenden Arzt.
Sonstige Anlaufstellen
Notaufnahme Marktredwitz: 09231 809-2120Kreissaal Marktredwitz: 09231 809-2016
.svg)